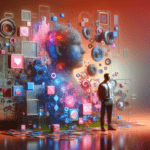Unterschiede zwischen Drohnenführerscheinen: A1/A3 vs. A2
Grundlagen der EU-Drohnenführerscheine
Was ist der EU-Kompetenznachweis A1/A3?
Der EU-Kompetenznachweis A1/A3, oft als „kleiner Drohnenführerschein“ bezeichnet, ist für den Betrieb von Drohnen in den offenen Kategorien A1 und A3 erforderlich. Er richtet sich an Piloten von Drohnen ab einem Abfluggewicht von 250 Gramm bis maximal 25 Kilogramm. Die Prüfung wird online beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) abgelegt und umfasst 40 Multiple-Choice-Fragen zu Themen wie Luftrecht, Flugsicherheit, Datenschutz und menschliches Leistungsvermögen. Ein Bestehen ist mit mindestens 75 % richtigen Antworten möglich, wobei die Prüfung beliebig oft wiederholt werden kann. Nach erfolgreichem Abschluss wird das Zertifikat als PDF bereitgestellt und kann optional im Scheckkartenformat bestellt werden.
Was ist das EU-Fernpilotenzeugnis A2?
Das EU-Fernpilotenzeugnis A2, auch als „großer Drohnenführerschein“ bekannt, ermöglicht den Betrieb von Drohnen in der offenen Kategorie A2, insbesondere in der Nähe von Menschen. Es ist erforderlich für Drohnen zwischen 500 Gramm und 2 Kilogramm, die näher als 150 Meter an unbeteiligte Personen heranfliegen sollen. Voraussetzung für den Erwerb ist der vorherige Abschluss des A1/A3-Kompetenznachweises sowie eine praktische Eigenerklärung über Flugerfahrung. Die Theorieprüfung umfasst 30 Fragen zu Themen wie Meteorologie, Flugleistungsdaten und Risikobewertung und wird bei einer anerkannten Prüfstelle abgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss wird das Fernpilotenzeugnis A2 ausgestellt, das eine Gültigkeit von fünf Jahren hat.
Warum gibt es unterschiedliche Drohnenführerscheine?
Die Unterscheidung zwischen den Führerscheinen A1/A3 und A2 basiert auf den unterschiedlichen Betriebsrisiken und Einsatzszenarien von Drohnen. Während der A1/A3-Nachweis für Flüge mit geringerem Risiko in der Nähe von Menschen oder in abgelegenen Gebieten vorgesehen ist, ermöglicht das A2-Zeugnis den Betrieb in komplexeren Umgebungen mit höherem Risiko. Diese Differenzierung stellt sicher, dass Drohnenpiloten entsprechend ihrer Einsatzbereiche geschult und geprüft werden, um die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten. Zudem fördert sie ein einheitliches Sicherheitsniveau innerhalb der EU und erleichtert die grenzüberschreitende Anerkennung der Qualifikationen. Durch die klare Strukturierung können sowohl Hobbyisten als auch professionelle Anwender ihre Drohnen verantwortungsbewusst einsetzen.
Vergleich der Einsatzbereiche: A1/A3 vs. A2
Flüge in den Kategorien A1, A2 und A3
Die EU-Drohnenverordnung unterteilt den Betrieb von Drohnen in drei Unterkategorien der offenen Kategorie: A1, A2 und A3. Kategorie A1 erlaubt Flüge über Menschen, jedoch nicht über Menschenansammlungen, und ist für Drohnen mit geringem Risiko vorgesehen. Kategorie A2 ermöglicht Flüge in der Nähe von Menschen, wobei ein Mindestabstand von 30 Metern (bzw. 5 Metern im Langsamflugmodus) einzuhalten ist. Kategorie A3 ist für Flüge in abgelegenen Gebieten vorgesehen, bei denen ein Abstand von mindestens 150 Metern zu Menschen und Wohngebieten eingehalten werden muss. Je nach Kategorie sind unterschiedliche Führerscheine und Anforderungen erforderlich, um den sicheren Betrieb der Drohne zu gewährleisten.
Welche Drohnen dürfen mit welchem Führerschein geflogen werden?
Die Art des erforderlichen Drohnenführerscheins hängt von der Drohnenklasse und dem geplanten Einsatzgebiet ab. Drohnen der Klasse C0 (unter 250 g) können in der Regel ohne Führerschein betrieben werden, sofern sie keine Kamera besitzen und nicht gewerblich genutzt werden. Für Drohnen der Klassen C1 bis C4 oder Bestandsdrohnen über 250 g ist der EU-Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich. Drohnen der Klasse C2, die näher an Menschen betrieben werden sollen, erfordern zusätzlich das EU-Fernpilotenzeugnis A2. Diese Regelungen stellen sicher, dass der Drohnenpilot über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, um die Drohne sicher und verantwortungsvoll zu betreiben.
Anforderungen und Prüfungen im Überblick
Voraussetzungen für den A1/A3-Nachweis
Um den EU-Kompetenznachweis A1/A3 zu erlangen, müssen Drohnenpiloten ein Online-Training absolvieren, das grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Luftrecht, Flugsicherheit, Datenschutz und menschliches Leistungsvermögen vermittelt. Anschließend ist eine Online-Prüfung mit 40 Multiple-Choice-Fragen beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) abzulegen. Ein Bestehen ist mit mindestens 75 % richtigen Antworten möglich, wobei die Prüfung beliebig oft wiederholt werden kann. Nach erfolgreichem Abschluss wird das Zertifikat als PDF bereitgestellt und kann optional im Scheckkartenformat bestellt werden. Dieser Nachweis ist fünf Jahre gültig und bildet die Grundlage für weiterführende Qualifikationen wie das EU-Fernpilotenzeugnis A2.
Voraussetzungen für das A2-Zeugnis
Für den Erwerb des EU-Fernpilotenzeugnisses A2 müssen Drohnenpiloten zunächst den A1/A3-Kompetenznachweis erfolgreich abgeschlossen haben. Zusätzlich ist eine praktische Eigenerklärung über Flugerfahrung erforderlich, die Übungen wie Start und Landung, stabilen Schwebeflug und kontrollierte Flugmanöver umfasst. Die Theorieprüfung besteht aus 30 Multiple-Choice-Fragen zu Themen wie Meteorologie, Flugleistungsdaten und Risikobewertung und wird bei einer anerkannten Prüfstelle abgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss wird das Fernpilotenzeugnis A2 ausgestellt, das eine Gültigkeit von fünf Jahren hat. Dieses Zeugnis erlaubt den Betrieb von Drohnen in der Nähe von Menschen unter Einhaltung spezif.
Online-Prüfung A1/A3: Ablauf und Inhalte
Die Online-Prüfung zum A1/A3-Nachweis wird vollständig digital über die Plattform des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA) durchgeführt. Nach einer Registrierung können Teilnehmer ein verpflichtendes Online-Training absolvieren, das als Grundlage für die Prüfung dient. Die Inhalte decken zentrale Aspekte des Drohnenbetriebs ab: rechtliche Grundlagen, Sicherheitsmaßnahmen, Schutz der Privatsphäre sowie Grundkenntnisse über Luftraumstrukturen. Die Prüfung besteht aus 40 Multiple-Choice-Fragen, wovon mindestens 30 korrekt beantwortet werden müssen. Nach dem Bestehen steht das Zertifikat sofort zum Download bereit und wird als offizieller Nachweis in allen EU-Mitgliedsstaaten anerkannt.
Theorieprüfung A2: Inhalte und Durchführung
Im Gegensatz zur A1/A3-Prüfung wird die Theorieprüfung für das A2-Zeugnis nicht online, sondern bei einer anerkannten Prüfstelle vor Ort abgelegt. Diese besteht aus 30 Fragen, die auf einem höheren Schwierigkeitsniveau formuliert sind. Themenschwerpunkte sind insbesondere Meteorologie, Flugleistungsberechnungen sowie Maßnahmen zur Risikominimierung im Flugbetrieb. Die Prüfung soll sicherstellen, dass der Pilot komplexere Situationen im urbanen oder semi-urbanen Raum sicher bewältigen kann. Nach Bestehen der Prüfung erhalten Teilnehmer das Fernpilotenzeugnis A2, das für Flüge mit höherem Risiko notwendig ist.
Praktische Eigenerklärung und Selbststudium für A2
Neben der Theorieprüfung ist für das A2-Zeugnis eine praktische Eigenerklärung verpflichtend. Diese ersetzt eine klassische praktische Prüfung, indem der Pilot seine Flugfertigkeiten im Selbststudium nachweist. Dazu gehören Starts, Landungen, kontrollierte Flugmanöver sowie das Verhalten bei Notfällen. Der Teilnehmer bestätigt durch Unterschrift, dass er diese Übungen unter realen Bedingungen durchgeführt und dokumentiert hat. Dieses Verfahren soll sicherstellen, dass der Drohnenpilot ausreichende praktische Erfahrung mitbringt, um sicher in der Nähe von Menschen zu operieren.
Technische Voraussetzungen und CE-Klassen
Bedeutung der CE-Klassenkennzeichnung
CE-Klassen sind ein zentrales Element der EU-Drohnenregulierung und definieren die technischen Eigenschaften und Sicherheitsanforderungen von Drohnen. Jede Drohne, die nach dem 1. Januar 2024 in der EU in Verkehr gebracht wird, muss eine entsprechende CE-Klassifizierung zwischen C0 und C6 tragen. Diese Klassifizierung berücksichtigt Faktoren wie Gewicht, Geschwindigkeit, Geräuschentwicklung, Ausstattung mit Geo-Fencing sowie Fernidentifikationssystemen. Die CE-Klasse entscheidet maßgeblich darüber, in welcher Kategorie und mit welchem Führerschein die Drohne betrieben werden darf. Sie ist somit ein wichtiges Instrument zur Risikobewertung und für die rechtliche Einordnung des Drohnenbetriebs.
Welche CE-Klasse erfordert welchen Führerschein?
Für Drohnen der CE-Klasse C0 ist kein Führerschein erforderlich, sofern sie nicht mit Kamera oder Sensoren zur Datenerfassung ausgestattet sind. C1-Drohnen erfordern den A1/A3-Nachweis, wenn sie über 250 Gramm wiegen, aber unter 900 Gramm bleiben. Für C2-Drohnen, die näher an unbeteiligte Personen heranfliegen dürfen, ist das A2-Fernpilotenzeugnis erforderlich. Drohnen der Klassen C3 und C4, die schwerer sind oder spezielle Betriebscharakteristika aufweisen, dürfen nur in der A3-Kategorie mit A1/A3-Nachweis geflogen werden. CE-Klassen schaffen somit klare Vorgaben, welche Ausbildung für den rechtssicheren Betrieb erforderlich ist.
Gültigkeit und Verlängerung der Führerscheine
Wie lange sind A1/A3 und A2 gültig?
Sowohl der Kompetenznachweis A1/A3 als auch das Fernpilotenzeugnis A2 sind jeweils fünf Jahre lang gültig. Nach Ablauf dieser Frist muss der jeweilige Nachweis erneuert werden, um weiterhin rechtmäßig Drohnen im entsprechenden Anwendungsbereich betreiben zu dürfen. In der Zwischenzeit sollten Piloten ihre Kenntnisse regelmäßig auffrischen, insbesondere bei Änderungen in der Gesetzeslage oder technischen Neuerungen. Die begrenzte Gültigkeitsdauer soll sicherstellen, dass das Wissen aktuell bleibt und das Sicherheitsniveau aufrechterhalten wird. Dies ist insbesondere relevant, da sich die Drohnentechnologie und deren regulatorisches Umfeld stetig weiterentwickeln.
Was ist bei der Verlängerung zu beachten?
Für die Verlängerung des A1/A3-Nachweises genügt in der Regel die Wiederholung der Online-Prüfung über das Portal des LBA. Für das A2-Zeugnis kann eine erneute Theorieprüfung erforderlich sein, sofern die Kenntnisse nicht durch regelmäßige Schulungen oder Auffrischungskurse nachgewiesen werden. Piloten sollten rechtzeitig vor Ablauf ihres Führerscheins die Verlängerung beantragen, um eine Unterbrechung ihres Flugbetriebs zu vermeiden. Eine lückenlose Gültigkeit ist vor allem bei kommerziellen Einsätzen entscheidend, da Versicherungen und Auftraggeber einen gültigen Nachweis fordern. Darüber hinaus empfiehlt sich eine kontinuierliche Weiterbildung, auch außerhalb der formalen Verlängerung.
Zuständige Behörden und Prüfstellen
Rolle des Luftfahrt-Bundesamts (LBA)
Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) ist in Deutschland die zentrale Behörde für die Erteilung und Verwaltung von Drohnenführerscheinen gemäß EU-Verordnung. Es betreibt die Online-Plattform zur Registrierung von Drohnenbetreibern und zur Abnahme der A1/A3-Prüfungen. Darüber hinaus überwacht das LBA die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und koordiniert nationale Regelungen mit der europäischen Agentur EASA. Auch bei Beschwerden oder rechtlichen Fragen zum Drohnenbetrieb ist das LBA erste Anlaufstelle. Mit seiner Funktion trägt es wesentlich zur sicheren und standardisierten Integration von Drohnen in den Luftraum bei.
Aufgaben der benannten Prüfstellen (PStF)
Benannte Prüfstellen (PStF) sind autorisierte Einrichtungen, die vom LBA zugelassen wurden, um die Theorieprüfung für das A2-Fernpilotenzeugnis durchzuführen. Diese Prüfstellen gewährleisten die Qualität und Korrektheit der Prüfungsdurchführung und stehen für Fragen zur Vorbereitung zur Verfügung. Sie bieten häufig auch weiterführende Schulungen oder Lernmaterialien an, um Teilnehmer optimal auf die Prüfung vorzubereiten. Der Zugang zur Prüfung erfolgt nach vorheriger Anmeldung, oft online, wobei die Prüfungen unter Aufsicht vor Ort stattfinden. Die Prüfstellen spielen eine wichtige Rolle, um das erforderliche Qualifikationsniveau der Drohnenpiloten sicherzustellen.
Kosten und Aufwand im Vergleich
Was kostet der A1/A3-Nachweis?
Der A1/A3-Nachweis ist vergleichsweise kostengünstig und richtet sich besonders an Hobbypiloten und Einsteiger. Die Registrierung beim Luftfahrt-Bundesamt und das Absolvieren der Online-Prüfung sind in Deutschland derzeit kostenlos. Einige zusätzliche Angebote wie ein Scheckkartenformat des Nachweises oder Schulungsmaterialien von Drittanbietern können jedoch kostenpflichtig sein. Da der gesamte Prozess online erfolgt, entstehen keine weiteren Gebühren für Anfahrt oder externe Prüfstellen. Insgesamt ist der A1/A3-Nachweis mit geringem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden und innerhalb eines Tages abschließbar.
Welche Kosten entstehen für das A2-Zeugnis?
Für das A2-Fernpilotenzeugnis fallen in der Regel deutlich höhere Kosten an. Die Theorieprüfung muss bei einer benannten Prüfstelle abgelegt werden, wofür Gebühren zwischen 100 und 200 Euro anfallen können, abhängig vom Anbieter. Hinzu kommen unter Umständen Kosten für Schulungsmaterialien, Vorbereitungskurse oder die Ausstellung von Teilnahmebescheinigungen. Auch die Anreise zur Prüfstelle ist ein möglicher Kostenfaktor. Trotz des höheren Aufwands ist das A2-Zeugnis für viele Nutzer unerlässlich, insbesondere wenn Flüge in bebauter Umgebung oder in der Nähe von Personen geplant sind.
Sonderfälle und Übergangsregelungen
Bestands- und Selbstbau-Drohnen: Was gilt?
Für Drohnen, die vor dem Inkrafttreten der EU-Verordnung im Umlauf waren – sogenannte Bestandsdrohnen – gelten Übergangsregelungen. Diese dürfen bis zum 31. Dezember 2026 unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin betrieben werden, auch wenn sie keine CE-Kennzeichnung besitzen. Die Einstufung erfolgt dabei anhand des Gewichts und der Einsatzzwecke in die Kategorien A1 bis A3, wobei meist der A1/A3-Nachweis ausreicht. Für selbstgebaute Drohnen gelten individuelle Anforderungen: Sie dürfen in der offenen Kategorie eingesetzt werden, benötigen aber eine Risikoabwägung und gegebenenfalls Genehmigungen. Nutzer solcher Drohnen sollten sich regelmäßig über aktuelle Änderungen informieren, da sich die Rechtslage dynamisch entwickeln kann.
Welche Regeln gelten ohne CE-Kennzeichnung?
Drohnen ohne CE-Kennzeichnung dürfen nur noch in Übergangsfristen eingesetzt werden, sofern sie bereits vor dem 1. Januar 2024 in Verkehr gebracht wurden. Der Einsatz ist nur in der offenen Kategorie gestattet, wobei Einschränkungen beim Gewicht und bei den Flugbedingungen zu beachten sind. Beispielsweise dürfen Geräte zwischen 500 g und 2 kg nur mit dem A2-Zeugnis geflogen werden, bei Einhaltung eines Mindestabstands von 50 Metern zu unbeteiligten Personen. Nach Ablauf der Übergangsfrist müssen Drohnen mit einer CE-Klassifizierung versehen sein, um weiterhin legal betrieben werden zu dürfen. Die CE-Kennzeichnung wird somit langfristig zum Standard für den Drohnenbetrieb in Europa.
Weitere rechtliche Pflichten für Drohnenpiloten
Registrierungspflicht für Betreiber
Seit Inkrafttreten der EU-Drohnenverordnung besteht eine generelle Registrierungspflicht für Drohnenbetreiber, deren Drohnen mehr als 250 Gramm wiegen oder über Sensoren zur Erfassung personenbezogener Daten verfügen. Die Registrierung erfolgt über das Online-Portal des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) und ist verpflichtend, unabhängig davon, ob der Flug gewerblich oder privat erfolgt. Nach erfolgreicher Registrierung erhält der Betreiber eine sogenannte eID (electronic identification number), die gut sichtbar an jeder Drohne angebracht werden muss. Diese Maßnahme dient der Rückverfolgbarkeit bei Vorfällen sowie der allgemeinen Transparenz im Luftraum. Eine fehlende Registrierung kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und führt bei Kontrollen zu Sanktionen.
Haftpflichtversicherung für Drohnenflüge
Für jeden Drohnenflug besteht die gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer speziellen Haftpflichtversicherung. Diese Versicherung muss Schäden abdecken, die durch den Drohnenbetrieb Dritten zugefügt werden – sowohl an Personen als auch an Sachen. Herkömmliche private Haftpflichtversicherungen reichen in der Regel nicht aus, es sei denn, sie schließen Drohnen ausdrücklich ein. Die Police muss bei Bedarf vorgezeigt werden können und ist Voraussetzung für den legalen Betrieb jeder Drohne, unabhängig vom Gewicht. Besonders bei kommerziellen Anwendungen oder in bebauten Gebieten ist eine ausreichend hohe Deckungssumme zu empfehlen, um im Schadensfall abgesichert zu sein.
Ausblick: Wann ist ein STS-Zertifikat erforderlich?
Unterschiede zu A1/A3 und A2
Ein STS-Zertifikat (Standard Scenario Certificate) wird dann erforderlich, wenn der geplante Drohnenflug nicht mehr in die offene Kategorie fällt, sondern unter die spezielle Kategorie (Specific Category) der EU-Verordnung. Diese betrifft Einsätze mit erhöhtem Risiko, etwa Flüge außerhalb der Sichtweite (BVLOS) oder in der Nähe von unbeteiligten Menschen bei schwereren Drohnen. Im Gegensatz zu den offenen Kategorien A1/A3 und A2, bei denen standardisierte Schulungen und Prüfungen ausreichen, ist für STS-Flüge eine genaue Risikobewertung und behördliche Genehmigung notwendig. Das STS-Zertifikat ist eine standardisierte Form dieser Genehmigung und vereinfacht den Betrieb innerhalb vordefinierter Einsatzszenarien.
Standardszenarien STS-01 und STS-02 im Überblick
Die EU hat derzeit zwei Standardszenarien definiert: STS-01 und STS-02. STS-01 bezieht sich auf Sichtflug innerhalb städtischer oder kontrollierter Gebiete mit einer Drohne unter 25 Kilogramm. STS-02 betrifft hingegen den Betrieb außerhalb der Sichtweite (BVLOS), jedoch in einer kontrollierten Umgebung, etwa in einem festgelegten Luftraum mit Zugangskontrolle. Für beide Szenarien ist eine spezielle Ausbildung mit praktischer Prüfung vorgeschrieben, die weit über die Anforderungen des A2-Zeugnisses hinausgeht. Darüber hinaus müssen Betreiber ein betriebliches Handbuch führen und eine Betriebserklärung abgeben. Diese Szenarien richten sich primär an professionelle Anwender wie Vermessungsdienste, Inspektionsunternehmen oder Sicherheitsdienste.